| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
Amazon-Bestellung:
Bitte MouseOver-Bild anklicken! |
| |
Kompromisse
und Halbwahrheiten oder: ein Stück aus dem realen Leben
Für
eine Weile gelingt es Adam, den Kompromissen und Halbwahrheiten
der hässlichen, der realen Welt zu entrinnen. Und er nimmt
den Leser mit auf eine seltsame und unaufdringlich-schöne
Reise, die alles bietet, was sich so manch einer erträumt,
der in der Mitte des Lebens verzweifeln möchte an der Schlechtigkeit
der Welt, an seiner eigenen Unfähigkeit, sich ihren Regeln
entweder unterzuordnen oder sie im Gebrauchsfall zu biegen und
notfalls zu brechen. Eine Reise, die, ungeachtet der Tatsache,
dass der Held diesem Alter längst entwachsen ist, angetrieben
wird von jugendlichem Übermut, die reizvolle Aussichten einschließt
und ungewöhnliche Alternativen, insbesondere die Möglichkeit,
eine Brücke zur eigenen Vergangenheit zu schlagen. Mit
staunenswerter Leichtigkeit wird der Leser eingestimmt, bis
er bereit ist, den Weg seines Helden als authentischen Versuch
einer radikalen Veränderung zu akzeptieren.
Der Betrüger ist bereits der vierte Roman des 1963
als Sohn einer angesehenen Richterfamilie in Pretoria geborenen
Südafrikaners Damon Galgut, der einmal sagte, aus Freud'scher
Sicht assoziiere er das Schreiben wahrscheinlich mit Liebe und
Aufmerksamkeit. "Einen Großteil meiner Kindheit war
ich krank und besitze Erinnerungen, wie mir am Krankenbett im
Hospital eine endlose Reihe von Verwandten vorliest." Den
Krebs, an dem er im Alter von sechs Jahren erkrankte, hat er
überwunden und zum Schreiben gefunden.
Adams Geschichte beginnt, als er an den staubigen Rand einer
kleinen Stadt zieht, in die Ödnis der Karoo, "einer Halbwüste
in der zentralen Hochebene Südafrikas", wie der Verlag
auf der Umschlagsseite des schön gestalteten Buches die
Handlung treffsicher verortet. Hier, so die Planung, will er
sich vom Verlust seiner Arbeit und seines Heims, kurz: von den
Verletzungen der besagten realen Welt erholen. Da trifft er
auf Canning, von dem ihm bestenfalls eine schemenhafte Erinnerung
aus seiner Kindheit geblieben ist und auf dessen rätselhafte
und schöne Frau, mit dem in der Welt der Gegensätze
zwischen Mann und Frau diskriminierenden Namen Baby. Canning
erbte von seinem ungeliebten Vater wirtschaftliche Unabhängigkeit
und diesen magischen Ort namens Gondwana, von dem Adam sich
nur allzu bereitwillig verführen lässt.
Doch auch der alternative Alltag will bewältigt sein, sprich:
das Häuschen will gereinigt, die Verwilderung des Gartens
im Zaum gehalten und ein kauziger, nicht einzuschätzender
Nachbar will beobachtet sein. Die ersten Tage und Wochen lässt
Adam die Verwahrlosung um sich greifen. Vielleicht gehört
dies zu seinem Bild der Profession, der anzugehören er
anstrebt. Schon einmal, als junger Mann, hat er mit einiger
Anerkennung einen Gedichtband veröffentlicht. Er ist überzeugt,
an den Anfangserfolg anknüpfen zu können. Da er von
vorneherein wusste, es würde nicht einfach werden, hat
er viel Geduld mit sich selbst, und das nötige Glück
verhilft ihm zur willkommenen Ablenkung. Er trifft auf Canning,
der ihn mit in sein Reich nimmt und es schafft, ihn in kürzester
Zeit darin einzubinden. Ob er ahnt, dass dies weniger seiner
- für ihn selbst tiefen - Freundschaft zu dem Helden seiner
Kindheit geschuldet ist, nicht einmal der Faszination für
die fantastische Landschaft, in die sein Anwesen eingebettet
ist, sondern eher den Verlockungen der kalten Schulter, die
Baby, die schöne Schwarze, dem Dauergast zeigt.
Schon bald verbringt Adam jedes Wochenende bei seinen neuen
Freunden, während er sich wochentags mit der Zähmung
der wilden Wörter und Pflanzen und der Annäherungsversuche
des sonderbaren Nachbarn herumplagt. Seltsam nur, dass er die
Veränderung, die mit ihm vor sich geht, nicht zu bemerken
scheint. Zunächst belügt er Canning, was sein Häuschen
anbelangt. In einem nahezu unbedeutenden Anfall von Scham verweist
er, nach seinem Haus gefragt, auf das des Nachbarn, weil das
von ihm bewohnte ihm allzu schäbig erscheint, als dass
er sich damit nach außen identifizieren könnte. Dann
belässt er Canning in dem Glauben, sich an ihre schicksalhafte
Begegnung in der Schule erinnern zu können. Dabei ist ihm
jegliche Erinnerung an diesen Kenneth, wie er mit Vornamen heißt,
genommen. Zu guter Letzt, der geübte Leser hat es längst
antizipiert, betrügt er den cleveren Geschäfts-, aber
naiven Privatmann Canning mit dessen innig geliebter Ehefrau,
mit Baby.
All dies erzählt Damon Galgut ohne Hast, fast beiläufig.
Gerade noch fragt sich der Leser, bei aller Schönheit der
Worte, worauf soll das Ganze hinaus laufen? Da ist er schon
eingesponnen und möchte mehr erfahren über dieses
so ungleich besetzte Trio. Erwartet Baby, dass Adam ihren Mann
ermordet? Ganz offensichtlich liebt sie diesen nicht. Aber liebt
sie ihn denn mehr? Liebt sie ihn so sehr, dass sie, als seine
Eva, in diesem Garten Eden leben möchte? Doch nicht metaphysische
Kräfte vertreiben sie aus dem Paradies, es sind die Pläne
Cannings, die dafür sorgen werden. Als Adam von ihnen erfährt,
beginnt für ihn diese andere Welt einzustürzen. Um
so mehr, als eine alte Dienerin ihn mit der Hausherrin in flagranti
erwischt. Obwohl Baby verspricht, sich um die Angelegenheit
zu kümmern, fürchten die beiden Liebenden von nun
an, ihr Geheimnis könnte verraten werden.
Ein anderes Geheimnis präsentiert sich dem Leser in der
besagten, scheinbaren Zweiteilung der Welt, in die reale und
die träumerische, außerhalb der Pflichten stehende.
Wodurch erzeugt der Autor Galgut diesen Eindruck, der beim Leser
die Sehnsucht nach dieser vom Alltag befreiten Welt bedient?
Es ist keineswegs so, dass eine tatsächliche Trennung vorgenommen
würde. Hat man zunächst den Eindruck, in der weißen
bürgerlichen Mittelschicht gelandet zu sein, in denen die
Schwarzen, wie zu Zeiten der Apartheid, nur als Bedienstete
anzutreffen sind, so sieht man sich plötzlich dem schwarzen
Bürgermeister jener Gemeinde gegenüber, an dessen
Rand Adam Zuflucht gefunden hat. Er ermahnt den Neuhinzugezogenen,
der Verwahrlosung des Gartens ein Ende zu setzen. Und als Baby
ihr Versprechen, sich um die Angelegenheit zu kümmern,
auf eine sehr drastische Weise einlöst, indem sie nicht
nur die alte Dienerin, sondern deren Mann gleich mit entlässt,
trifft der Leser auf einen weiteren Vertreter der aufsteigenden
schwarzen Mittelschicht. Doch auch hier, erfährt er nebenbei,
hat der Zerfall der Familie, des familiären Zusammenhalts
bereits begonnen.
Das von Baby gekündigte Ehepaar taucht Tage später
bei Adam auf und bittet um Hilfe. Da er sich mitschuldig fühlt
am Jobverlust der Alten, nimmt er sie auf und kontaktiert ihren
Sohn. Dieser arbeitet als Dozent für Politologie in Kapstadt
und findet erst Tage später die Zeit, sich seiner Eltern
anzunehmen. Doch im Vordergrund steht weniger die Sorge um seine
Angehörigen, als vielmehr die ideologische Abgrenzung zum
weißen Mann. Warum kümmere er sich nicht um
seine Eltern, fragt er anmaßend.
Die Aufhebung der Vorherrschaft der weißen Bewohner Südafrikas
ist ein Element, das für
eine Verankerung der Romanhandlung in der realen Welt spricht.
Es überschneidet sich mit einem anderen, mit dem der Geschäftswelt,
die vorrangig durch Canning repräsentiert wird, dessen
Geschäftspartner Weiße, vor allem aber einflussreiche
Schwarze sind. Beständig ist Canning in irgendwelche Besprechungen
eingebunden, was Adam und Baby erst die Möglichkeit eröffnet,
eine Affäre zu beginnen. Der zweite Vertreter dieser Gesellschaftsschicht
ist Adams Bruder Gavin. Er hat Adam das Häuschen in dieser
abseitigen Welt zur Verfügung gestellt und bietet ihm Hilfe
an, wo immer dieser bereit ist, eine solche anzunehmen.
Verschiedene Zeichen deuten auf den Zusammenbruch der traumartigen
Welt. Er vollzieht sich jedoch erst in dem Moment, als Adam
sich von der Stimme, von dem Geist verabschiedet, dessen Anwesenheit
er in der anderen Welt spürte, in erster Linie in seiner
abseits gelegenen Wohnstätte. Adam ist nach Kapstadt zurückgekehrt
und plaudert beim Essen in einem Restaurant mit seinem Bruder
und dessen Frau. Nachdem er - nicht sehr ernsthaft - die Rede
auf diesen Geist bringt, lockt seine Schwägerin ihn zu
weit ins offene Feld, indem sie Parallelwelten ins Gespräch
bringt. Nun zieht sich Adam zurück und rückt die symbolische
Welt zurecht, d.h. er weist ihren Elementen den gebührenden
Platz im Realen zu: Obwohl er sich in dem Haus nie allein gefühlt
habe, "glaubte er nicht an Parallelwelten und unsichtbare
Wesen. Er begriff besagten ‚Geist' vielmehr als einen abgespaltenen
Teil seines Bewusstseins, real und imaginär zugleich, eine
Art Abfallprodukt seiner Depression".
Adams
Versuch, das Erlebte ins Reich des Symbolischen zu verweisen,
muss scheitern. Sein hässlicher Kern bleibt bestehen und
ragt weithin sichtbar ins Reale: die Schönheit Gondwanas
wird trotz aller Proteste der Umweltschützer der neuen
Funktion geopfert, und Adam muss erkennen, dass er daran nicht
unschuldig ist. Und auch jenes rätselhafte, Adam widerwärtig
anmutende Ding, das sein Nachbar speziell für ihn angefertigt
hat, findet seinen Weg in die reale Welt und erinnert den Leser
und wohl auch Adam selbst an eine weitere, weitaus größere
Schuld. Eine einsame Entscheidung, möchte man mit dem der
Tragweite vielleicht angemessenen Pathos formulieren, stand
in rabenschwarzer Nacht an. Eine damals richtig getroffene
Entscheidung hätte ein Menschenleben zu retten vermocht
und sein eigenes zur Disposition gestellt. Doch zu diesem Zeitpunkt
hatte der Betrüger seinen Weg zurück in die reale
Welt der Halbwahrheiten und Kompromisse bereits vollendet.
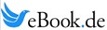
Alle Bücher von
Damon Galgut
|
|
(Originaltitel:
The Impostor)
04/2009
© by Janko Kozmus |