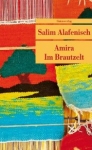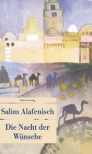|
Literarisches Portrait: Salim AlafenischKritischer Blick auf das literarische Schaffen von Salim Alafenisch Spätestens mit der 2007 erscheinenden autobiografischen Erzählung Die Feuerprobe stellt der deutsch schreibende palästinensische Schriftsteller seinen Märchen und märchenhaften Geschichten ein Werk zur Seite, das eindeutig mit der geo- und sozialpolitischen Wirklichkeit der Region verbunden ist, die der Autor auch in diesem Buch zum Handlungshintergund erhebt. Es ist dies die von palästinensischen Beduinen bevölkerte, zu Israel gehörende Negev-Wüste, die Heimat von Salim Alafenisch. 1948, ein halbes Jahr nach Gründung Israels, wird der Sohn eines Scheichs, dessen Kamele er später hüten wird, in dieser Region geboren. Erst im Alter von 14 Jahren wird er alphabetisiert. Später besucht er das Gymnasium in Nazareth, wo er im Jahre 1971 sein Abitur ablegt. Bald darauf verlässt Salim Alafenisch seine Heimat, um nach einem Jahr am Londoner Princeton College nach Heidelberg überzusiedeln und an der dortigen Universität Soziologie, Ethnologie und Psychologie zu studieren. Während und auch nach dem Studium setzt sich Alafenisch wissenschaftlich mit der Kultur seines Volkes auseinander. So entsteht u.a. 1982 eine Abhandlung zum Stellenwert der Feuerprobe[1]. Ende der 80er Jahre erscheint mit Der Weihrauchhändler Alafenischs erste Erzählungssammlung, geschrieben in Deutsch! In Abständen von ein bis drei Jahren erscheinen fünf weitere Bände, die eng mit der Tradition der beduinischen Oralliteratur verknüpft sind. Märchenhafte Geschichten, die mündlich von Generation zu Generation überliefert wurden. Der Autor selbst erlernte die Kunst des Geschichtenerzählens von seiner Mutter[2]. Der Züricher Unionsverlag, Herausgeber sämtlicher Bände des Autors, verzichtet auf eine Gattungsbezeichnung. Eine Ausnahme stellt die besagte Erstveröffentlichung dar. Die in dem Band Der Weihrauchhändler, der zunächst bei einem kleinen Berliner Verlag erschien, versammelten Geschichten werden als "Märchen und Geschichten aus dem Zeltlager der Beduinen" beschrieben. Vielleicht trug diese, der Erwartungshaltung des okzidentalen Publikums entgegen eilende Paraphrase zur Geringschätzung innerhalb der Literaturkritik bei, wiewohl sie beim breiten Publikum ihre Wirkung nicht verfehlte. Der Literaturkritiker Heinz Hug geht 1990 in einem Aufsatz über arabische Literatur[3] auf einen Literaturstreit ein. Betrachtet wird einmal die Produktion der zum Teil im Exil lebenden arabischen Schriftsteller, die "vorwiegend an sozialkritische bzw. realistische, nicht selten in der Konfrontation mit europäischer Kultur entstandene Traditionslinien" anknüpfen, aber mit ihren Übersetzungen geringe Verkaufszahlen erzielten. Hingegen verzeichneten die in Deutsch schreibenden Autoren Rafik Schami und Salim Alafenisch, die sich selbst in der Tradition arabischer Erzähl- und Märchenliteratur sehen, einen großen Publikumserfolg. Den literarischen Streit in diesem Kontext habe Hartmut Fähndrich, ein Kenner und inzwischen preisgekrönter Übersetzer arabischer Literatur entfacht. Fähndrich habe vom "Alafenisch-Syndrom" gesprochen und "ein Ungleichgewicht von literarischer Qualität und Publikumserfolg" konstatiert. Mag auch die Literaturkritik Alafenischs, in der Tradition arabischer Oralliteratur stehenden Erzählungen wenig Achtung entgegenbringen, so entzieht sich das autobiografische Werk Die Feuertaufe m. E. schon allein deshalb einer vorschnellen Be- und Aburteilung, weil es - wie eingangs erwähnt - fest in der geo- und sozialpolitischen Wirklichkeit verankert ist. Es stellt literarisch überzeugend dar, wie das beduinische Gewohnheitsrecht der Feuertaufe trotz widrigster Bedingungen in der von politischen Gegensätzen geschüttelten Region umgesetzt wird: Obwohl die Anschuldigung aus den Reihen eines Beduinenstamms für die Zeugenschaft an einen Mord weder mit Beweisen noch mit Indizien hinreichend untermauert ist, erklärt sich ein anderer Beduinenstamm bereit zur Feuerprobe. Salim Alafenisch berichtet in dieser autobiografischen Erzählung von einer wahren Begebenheit. Der beschuldigte Beduinenstamm war sein eigener und der stellvertretend für die Ehre des Stammes sich zur Verfügung stellende Beduine war der Sohn des Scheichs, der Bruder des Autors. Es ist eine unruhige Zeit im Süden Israels, in der Wüste Negev. Nach einem ersten Anschlag der Fatah im Jahr 1966 werden Truppen in der Nähe der Beduinen stationiert, deren Bewegungsfreihet dadurch eingeschränkt ist. Da ein kompetenter Richter für die Abnahme der Feuerprobe nur außerhalb der Grenzen zu finden ist, wird diese ausgesetzt, bis zum Jahr 1980. Die Spannung über den Ausgang des archaischen Rituals, bei dem die Zunge des Probanden dreimal über ein glühendes Stück Eisen geführt werden muss, erhöht der Autor, indem er - stellenweise detailliert - auf die Sorgen und Nöte, kurz: auf das Alltagsleben seines beduinischen Volkes innerhalb der Erzählzeit eingeht. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1948
1971 1973 1982 1983 1984-1989
1988
1989 1990 1993
1994
1996 1998 2007 Salim Alafenisch lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in Heidelberg. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (noch nicht aufgenommen) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1)
Salim Alafenisch: Der Stellenwert der Feuerprobe
im Gewohnheitsrecht der Beduinen des Negev. 4)
In einem Interview erklärt Salim Alafenisch, er habe trotz der
abgeschiedenen Lebensweise eines Beduinen die Geschehnisse in seinem
Land mitgekriegt: ".. man hört von den Ereignissen, Verwandte
sind betroffen. In meinem Land ist Krieg, 67, habe ich auch beigewohnt.
Ja, vielleicht deshalb gefragt, wie fühlt man sich. Ich habe
das Land verlassen, weil ich das Gefühl hatte, das Land ist für
mich zu eng geworden". - Vgl. Hanselmann-Interview a.a.O. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Der Stellenwert der Feuerprobe im Gewohnheitsrecht der Beduinen des Negev, Abhandlung von S. Alafenisch | |||||||||||||||||
| Heinz Hug: Über die deutschsprachige Rezeption von arabischer Oralliteratur | |||||||||||||||||
| Kleine Kerzen in der Dunkelheit zünden: Salim Alafenisch im Interview mit Matthias Hanselmann, Deutschlandradio, 15.5.2008 | |||||||||||||||||
| 2012
© by Janko Kozmus |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Archaische Suche nach Wahrheit (zu: Die Feuerprobe) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Sahar Khalifa, Palästina | |||||||||||||||||
| Alaa al Aswani, Ägypten | |||||||||||||||||
| Tahar Ben Jelloun, Marokko | |||||||||||||||||
| Assia Djebar, Algerien |
|||||||||||||||||
| Tarek Eltayeb, Sudan | |||||||||||||||||
| Gamal al-Ghitani, Ägypten | |||||||||||||||||
| Khalil Gibran, Libanon |
|||||||||||||||||
| Yasmina Khadra, Algerien | |||||||||||||||||
| Mohammed Khaïr-Eddine, Marokko | |||||||||||||||||
| Abbas Khider, Irak/Deutschland |
|||||||||||||||||
| Elias Khoury, Libanon |
|||||||||||||||||
| Ibrahim al-Koni, Libyen |
|||||||||||||||||
| Amin Maalouf, Libanon |
|||||||||||||||||
| Nagib Machfus, Ägypten |
|||||||||||||||||
| Alia Mamduch, Irak |
|||||||||||||||||
| Nawal El Saadawi, Ägypten |
|||||||||||||||||
| Boualem Sansal, Algerien | |||||||||||||||||
| Rafik Schami, Syrien/Deutschland |
|||||||||||||||||
| Hamid Skif, Algerien | |||||||||||||||||
| Ahdaf Soueif, Ägypten | |||||||||||||||||
| Miral al-Tahawi, Ägypten |
|||||||||||||||||
| Najem Wali, Irak | |||||||||||||||||
| Mustafa Zikri, Ägypten |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|